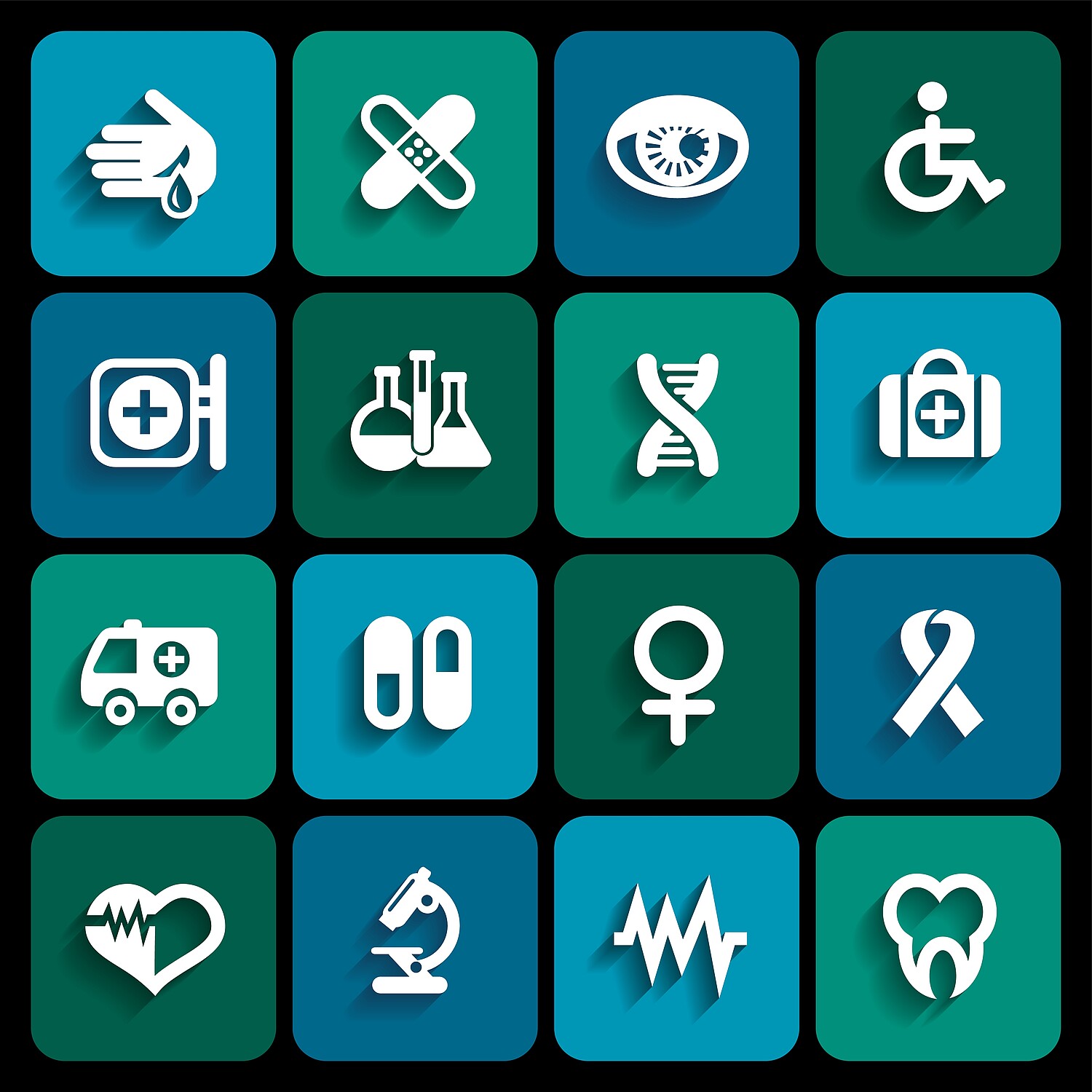
Künstliche Intelligenz kann Menschenleben retten
Schon heute ist KI bei Diagnosen und Therapien häufig schneller und genauer als ein Durchschnittsarzt. Dadurch verspricht das Gesundheitswesen nicht nur besser zu werden, sondern auch gerechter.
In der Notrufzentrale geht ein Anruf ein. Die Frau am anderen Ende der Leitung erzählt aufgeregt, ihr Mann sei im Garten bewusstlos zusammengebrochen. Der diensthabende Disponent versucht sie zu beruhigen, um schnell herauszufinden, was passiert ist. Eine Maschine hört mit, analysiert die Stimme der Frau, schlägt systematisch Fragen vor, die der Diensthabende ihr stellen kann, um aus den Antworten zur richtigen Diagnose zu gelangen. Innerhalb kurzer Zeit schlägt die Maschine Alarm: «Herzstillstand!» Der Disponent benachrichtigt sofort den Notarzt und gibt der Anruferin Anweisungen für eine wirksame Herzdruckmassage, bis die Helfer eintreffen.
Trainiert mit unzähligen Anrufen
Dieser Fall könnte sich so oder ähnlich in einer dänischen Notfallzentrale abgespielt haben. Dort hört immer auch eine Maschine mit. Das Unternehmen Corti hat hierfür eine Lösung entwickelt, die mit zehn Millionen Notfallanrufen trainiert wurde. Schneller und zuverlässiger als der Mensch stellt die Maschine fest, ob ein Herzstillstand vorliegt. Je früher ein Betroffener Wiederbelebungsmassnahmen erfährt, umso besser. Jede Sekunde zählt, damit Gehirn- und Herzzellen nicht absterben. Künstliche Intelligenz kann also Leben retten.
Nachholbedarf der Schweizer Spitäler
Doch das ist nur ein Beispiel für intelligente digitale Lösungen im Gesundheitswesen. «Die Chancen sind immens», betont ZHAW-Gesundheitsökonom Alfred Angerer. «KI-Lösungen könnten das Gesundheitswesen revolutionieren.» Die Realität sei davon aber noch weit entfernt, wie der Leiter der Fachstelle Management im Gesundheitswesen am Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie (WIG) der ZHAW sagt. Dies gilt vor allem auch für die Schweiz. Viele Spitäler hätten hierzulande noch grossen Nachholbedarf bezüglich Digitalisierung und KI. Und das, obwohl die Zahl der Veröffentlichungen zu neuen Anwendungen jedes Jahr exponentiell ansteigt. «Hier den Überblick zu bewahren, was wir wirklich brauchen und was dagegen nur Spielerei ist, ist eine grosse Herausforderung», räumt Angerer ein. Viele Spitäler stellen Innovationsmanager oder Digital-Health-Manager ein, um die Möglichkeiten zu sondieren.
«Digital Health – Revolution oder Evolution?»
Die ZHAW hat in der Studie «Digital Health – Revolution oder Evolution?» die grossen Veränderungen klassifiziert und Handlungsempfehlungen entwickelt. Dabei haben sich die Studienautoren des WIG auf drei Themenfelder entlang der Wertschöpfungskette im Gesundheitsbereich fokussiert: «Information und Prävention», «Kontaktpunkte und Patientenfluss» sowie «Diagnose und Therapie».
«Information und Prävention»
Das Themenfeld «Information und Prävention» zeigt, wie unzählige Gesundheits-Applikationen für Laien entwickelt werden. Mit der App der holländischen Firma Skin Vision etwa kann man zu Hause Hautveränderungen fotografieren und prüfen, ob es sich um Hautkrebs handelt oder nicht. Mit anderen Apps können Laien bei sich selbst diabetische Netzhautveränderungen, Herzrhythmusstörungen oder Alzheimer diagnostizieren. Sie können sich selbst vermessen, damit ihren Gesundheitszustand überprüfen und mit ihren aufgezeichneten Daten auch die Gesundheitsforschung unterstützen. «Bei einigen dieser Lösungen sind die klinischen Studien sehr vielversprechend», sagt Angerer, der auch stellvertretender Leiter des ZHAW Digital Health Lab ist (siehe Box).
Facebook diagnostiziert Depressionen
Doch nicht nur bei körperlichen Beschwerden soll Doktor KI zum Einsatz kommen, auch bei psychischen Krankheiten soll er die richtige Diagnose stellen. Seit Jahren wird in diesem Bereich experimentiert. Einer grösseren Öffentlichkeit wurde dies bekannt, als Facebook bereits 2017 behauptete, anhand der Postings in seinem sozialen Netzwerk zu erkennen, ob jemand depressiv sei oder nicht. Ein spezieller Algorithmus hilft bei der Analyse und schlägt Alarm. 3500 Suizidalarme pro Jahr sollen so ausgelöst worden sein. Facebook-Mitarbeitende schreiben die betroffenen Leute dann an und teilen ihnen mit, wo sie Hilfe erhalten. Wissenschaftlich erwiesen ist die Diagnosequalität aber noch nicht, wie Angerer anmerkt.
«Kontaktpunkte und Patientenfluss»
Doch wer Hilfe bei Gesundheitsproblemen braucht, egal welcher Art, soll immer möglichst rasch an die richtige Stelle gelangen können. Deshalb bestehen im zweiten Veränderungsfeld «Kontaktpunkte und Patientenfluss» grosse Hoffnungen, dass Künstliche Intelligenz und andere digitale Lösungen helfen, Menschen richtig durch das Gesundheitssystem zu steuern. Wie gross hier der Bedarf ist, zeigt ein Blick in die Statistiken der Notfallaufnahmen von Schweizer Spitälern. 30 bis 50 Prozent der Menschen, die heute in die Notaufnahme kommen, gehören dort eigentlich gar nicht hin. Ein Besuch beim Hausarzt hätte ausgereicht. Oder mit der Konsultation der richtigen Digital-Health-Lösung hätten sie sogar zu Hause bleiben können.
Prognose-Tool für Personalkapazitäten
Mit intelligenten Systemen lassen sich auch Personalkapazitäten und Patientenströme effektiver und effizienter planen, wie der Forscher an einem anderen Beispiel verdeutlicht: «An einem Festanlass, wie dem Albani-Fest in Winterthur, kommen erfahrungsgemäss mehr Menschen mit Schnittwunden oder Alkoholvergiftung ins Spital. Gefüttert mit den entsprechenden Parametern der vergangenen Jahre, ergänzt durch Wetterdaten und sonstige relevante Informationen, könnte ein Prognose-Tool im Voraus berechnen, wie viel medizinisches Personal an einem solchen Wochenende gebraucht würde.»
«Diagnose und Therapie»
Die grösste Aufmerksamkeit, wenn es um KI im Gesundheitswesen geht, erhält das Veränderungsfeld «Diagnose und Therapie». Künstliche Intelligenz (vor allem Machine Learning) wird medizinisches Personal künftig verstärkt bei der Erkennung von Mustern und Auffälligkeiten bei Laborwerten unterstützen. Auch Radiologen können bei ihrer Aufgabe entlastet werden, wenn es etwa darum geht, Aufnahmen während und nach der Behandlung von Metastasen haargenau auf Veränderungen hin zu vergleichen. Die Universitätsklinik in der deutschen Stadt Essen setzt beispielsweise bei der Diagnose von Lungentumoren und Prostatakrebs auf KI. «Die Maschine scheint hier dem medizinischen Personal überlegen und kann in Abbildungen, die mittels Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) entstanden sind, Tumore viel schneller und zuverlässiger erkennen.
Angenehme Nebenwirkung
Ein angenehmer Nebeneffekt: Die Maschinen brauchen weniger Bilder sowie weniger kontrastreiche Aufnahmen. In der Folge muss den Patienten weniger Kontrastmittel gespritzt werden, was wiederum schonender und kostengünstiger ist. Auch bei diabetischen Netzhautveränderungen (diabetische Retinopathie) erkennt ein Deep-Learning-Algorithmus anhand der Aufnahme zuverlässiger als jeder Arzt, ob sich Blutgefässe der Netzhaut verschliessen, was im Extremfall zur Erblindung eines Patienten führen kann.
OP-Robotik in den Kinderschuhen
Grosse Erwartungen werden auch in OP-Robotik und Pflegerobotik gesetzt. Diese stecke jedoch erst in den Kinderschuhen und könne noch wenig Erfolge vorweisen, so der Digital-Health-Experte. Das gilt vor allem dann, wenn der Roboter nicht nur das machen soll, wozu er programmiert wurde, sondern von seiner Umwelt lernen soll, was der Patient gerade braucht.
Qualität und Gerechtigkeit
«Bezüglich Genauigkeit und Schnelligkeit in Diagnose und Therapie sind Maschinen häufig besser als ein Durchschnittsarzt», unterstreicht Angerer. Damit bringe KI nicht nur unter Qualitätsaspekten grosse Veränderungen mit sich, sondern auch aus medizinisch-ethischer Sicht: «Der Behandlungserfolg bleibt weniger dem Zufall überlassen. Ob ein Tumor rechtzeitig entdeckt wird, hängt nicht davon ab, welcher Arzt gerade Dienst hat.» Das führe zu mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit im Gesundheitswesen.
Spracherkennungsysteme für Ärzte
Aus Patientensicht vordergründig wenig interessant, für Spitäler aber umso mehr sind die Möglichkeiten, wie intelligente Systeme administrativ im Hintergrund eingesetzt werden können, wie Angerer betont. So haben Studien des WIG ergeben, dass ein Arzt gerademal nur rund 20 Prozent seiner Zeit direkt in Kontakt mit Patientinnen und Patienten ist. In 80 Prozent der Zeit macht er anderes: Er schreibt Reporte, verfasst Arztbriefe, sitzt in Sitzungen, konsultiert Studien, legt Wege im Spital zurück und vieles mehr. Intelligente Spracherkennungssysteme, die Sprache in Text umwandeln und strukturiert ablegen können, sollen hier entlasten und mehr Zeit für Patientenkontakte ermöglichen.
Suche nach Therapieerfolgen und Krankheitsmustern
Mit Hilfe von anderen KI-Systemen könnten aber auch Millionen von Patientenakten relativ schnell nach früheren Behandlungserfolgen oder zu Forschungszwecken nach neuen Mustern und Krankheitsbildern durchsucht werden. Selbst der Prophylaxe von Infektionen oder Stürzen kann dies dienen. Das Universitätsspital Essen experimentiert mit einer Sturzprophylaxe im Klinikalltag. Denn für ältere Patienten, die an mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden, ist ein Oberschenkelhalsbruch häufig ein Todesurteil. Dank Künstlicher Intelligenz versucht das Spital zu analysieren, welche Patienten besonders gefährdet und welche Situationen besonders gefährlich sind. «Bei den Auswertungen der Akten ergeben sich vielleicht Korrelationen, die bisher nicht aufgefallen sind», so Angerer.
Scheinkorrelationen
Manchmal entpuppen sich Analyseresultate jedoch auch als Scheinkorrelationen, wie das Beispiel einer KI zeigt, die Microsoft trainierte, um Lungenentzündung zu verstehen und die Überlebenschancen auszurechnen. Die Maschine kam zu einem überraschenden Befund: Menschen mit Asthma überleben Lungenentzündungen häufiger. Die logische Erklärung hierfür mussten Wissenschaftler aus Fleisch und Blut liefern: Weil Menschen mit Asthma häufiger zum Pneumologen gehen, ist die Chance grösser, dass Lungenentzündungen rechtzeitig erkannt werden.
Fehlende Transparenz bei KI-Anwendungen
Trotz aller Fortschritte und Hoffnungen: Die Herausforderungen bezüglich KI-Anwendungen im Gesundheitswesen sind gross. An erster Stelle nennt Angerer hier die fehlende Transparenz darüber, wie Maschinen zu Antworten und Entscheidungen kommen. Selbstlernende Systeme sind häufig noch Blackboxen. Das erläutert er an einem Beispiel der Geschlechtererkennung allein anhand einer Abbildung der Netzhaut. Kein Mensch kann mit Bestimmtheit sagen, ob es sich beim abgebildeten Muster um die Netzhaut einer Frau oder eines Mannes handelt. Ein Google-Algorithmus erreicht eine Trefferquote von 97 Prozent. «Wie der Algorithmus das schafft, weiss man nicht» sagt Angerer.
«In Zukunft werden Maschinen zusehends entscheidungsrelevante Ergebnisse generieren.»
Viele Ärzte störe das nicht: Wenn die Maschine in 97 Prozent der Fälle recht hat, ist das halt so und gut. Viele andere Ärzte wiederum haben ein schlechtes Gefühl dabei, wenn sie bei den drei Prozent der Patienten, die sie vielleicht falsch operieren aufgrund einer falschen Algorithmusempfehlung, nicht nachvollziehen können, wie die Fehlentscheidung zustande kam. «In Zukunft werden Maschinen zusehends entscheidungsrelevante Ergebnisse generieren», sagt Angerer. Deshalb sei es wichtig, auf der technologischen Seite die Sicherheit, Robustheit und hinreichende Nachvollziehbarkeit von automatisierten Entscheidungsprozessen zu gewährleisten.
Wer überbringt die schlechten Nachrichten?
Jede Maschine ist auch nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert wird. Obendrein müssen es viele Daten sein, damit Machine Learning erfolgreich ist. Dementgegen stehen Sicherheitsaspekte und Datenschutzbedenken. Grundsätzliche Akzeptanzprobleme bezüglich des Einsatzes von KI sieht Angerer aber weder bei Gesundheitspersonal noch bei Patientinnen und Patienten. Im Gegenteil: «Bisher haben die Ärzte keine Angst, durch Künstliche Intelligenz ersetzt zu werden. Intelligente Systeme werden heute meist nur als Zweitmeinung verwendet – unterstützen also das medizinische Personal für mehr Qualität und zum Wohl der Patienten», stellt der Gesundheitsökonom fest. Und für Patientinnen und Patientinnen zähle letztlich die Qualität der Behandlung: «Wenn es in einem Spital weniger Entzündungen, Infektionen und Komplikationen gibt als im anderen, ist es ihnen egal, wie das gelingt.» Heikel werde es lediglich in einem Bereich: «Keiner will von einer Maschine mitgeteilt bekommen, dass er nur noch drei Monate zu leben hat», sagt Angerer. Für solche hochsensiblen Bereiche, wo viel Empathie gefragt ist, brauche es nach wie vor den Arzt und seine menschliche emotionale Intelligenz.
ZHAW Digital Health Lab
Das ZHAW Digital Health Lab wurde 2018 ins Leben gerufen und ist eine interdisziplinäre Plattform von Forschenden aus verschiedenen Bereichen der Hochschule. Es wird von einem sechsköpfigen Vorstand geleitet. Kürzlich fand der 1. Digital Health Lab Day statt, bei dem ZHAW-Forschende sowie Praktikerinnen und Praktiker die neuesten Trends und Lösungen aus dem Bereich Digital Health vorgestellt und mit rund 200 Teilnehmenden diskutiert haben. Dort wurde auch die Studie «Digital Health – Revolution oder Evolution?» erstmals vorgestellt, die helfen soll, die neusten Entwicklungen einzuordnen, und die darüber hinaus Handlungsempfehlungen beinhaltet.
0 Kommentare
Sei der Erste der kommentiert!