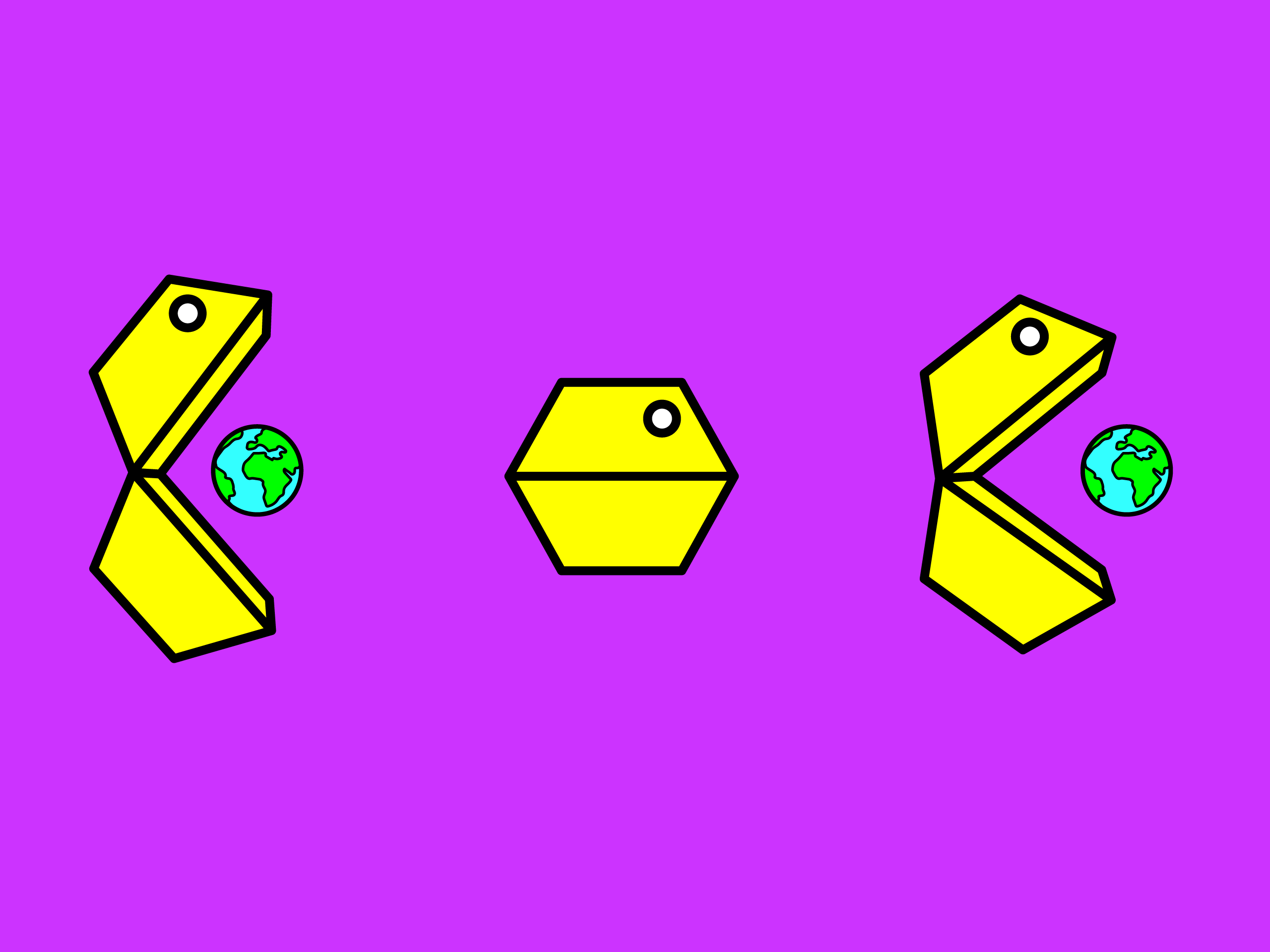
Planetary Health Folge 8: Disruption durch Destruktion
Metasynthese einer neuen Ernährungskultur: Wozu die Entwertung bestehender Strukturen im Ernährungssystem führt.
Es gibt Momente in der Geschichte, in denen das Gewohnte nicht mehr trägt. Dann brechen Systeme, die einst als unumstösslich galten, auseinander. Was gestern noch sicher erschien – das Brot des Bäckers, die Milch der Kuh, das Fleisch auf dem Teller – verliert über Nacht seine Selbstverständlichkeit. Disruption durch Destruktion ist nicht nur eine technologische oder wirtschaftliche Dynamik. Es ist ein epistemischer Umbruch. Eine radikale Metamorphose dessen, was wir essen, wie wir es produzieren und welche Geschichten wir darüber erzählen. Doch Zerstörung allein wirkt nicht oder nicht wie gewünscht. Nach dem Feuer bleibt Asche, aber kein Wald. Die eigentliche Frage ist: Wie schaffen wir eine Synthese aus dem, was war, und dem, was sein könnte?
1. Die Architektur des Umbruchs: Wenn Nahrung sich selbst entzieht
Stellen wir uns eine Welt vor, in der die Kühe verschwinden. Nicht durch eine Seuche oder eine Katastrophe, sondern weil die Konsumentinnen und Konsumenten es so wollen. Pflanzliche Alternativen wie Hafer-, Soja- und Nussdrinks ersetzen Kuhmilch. Manche Menschen trinken keine tierische Milch mehr, und was über Jahrtausende ein Symbol für Nahrung, Kultur und Identität war, wird vielleicht irgendwann plötzlich zur Randerscheinung. Die Kuh wird über ihre Klimagasemission zum Problem und gleichzeitig zum Opfer stilisiert. Doch die Revolution stockt. Einstige Vorreiter dieser Bewegung taumeln finanziell. Die klassischen Molkereien sind beeindruckt, aber lange nicht besiegt. Die Antizipation neuer Technologien findet statt. Während viele Verbraucher auf pflanzliche Alternativen umsteigen, greifen andere bewusst wieder zum Glas Vollmilch.
Die strukturelle Disruption ist unübersehbar: Pflanzliche und biotechnologische Alternativen verändern Märkte, Produktionsweisen und Konsumstrukturen. Dennoch zeigt sich, dass der Wandel nicht linear verläuft. Eine vollständige Verdrängung traditioneller Produkte erscheint unwahrscheinlich. Vielmehr zeichnen sich hybride Lösungen ab, in denen tierische und pflanzliche Produkte miteinander verschmelzen. Fleischähnliche Produkte können ganz oder teilweise aus pflanzlichen Zutaten bestehen, während Milch nicht nur aus Hafer, sondern auch durch Präzisionsfermentation hergestellt wird.
Die Dekonstruktion des linearen Ernährungssystems eröffnet dabei eine neue Möglichkeit: eine zirkuläre Metasynthese, in der Abfälle, Seiten- oder Nebenströme zu Ressourcen werden und sich Wertschöpfungsketten als Wertschöpfungsnetzwerke neu ordnen. Doch wie wird dieser Wandel wahrgenommen? Erzeugt er Akzeptanz – oder Widerstand?
2. Die grosse Überschneidung: Nahrung als Medizin, Essen als Technologie
Die Ernährung der neuen Gegenwart wird nicht nur ökologischer, sondern auch funktionaler. In den Labors der Biotechnologie wird Essen neu gedacht. Der Longevity-Trend zeigt, dass Nahrung nicht mehr nur der Sättigung dient, sondern als gezielte Intervention gegen den Alterungsprozess eingesetzt wird. Polyphenole aus Pflanzen, fermentierte Adaptogene oder mikrobiomoptimierte Lebensmittel sollen nicht nur ernähren, sondern Vitalität sichern und sogar Lebenszeit verlängern. Gleichzeitig entsteht eine epistemische Spannung zwischen Natur und Technologie. Algorithmisch optimierte Nahrung ergänzt zunehmend sensorische Erfahrungen. Natürlichkeit wird neu definiert – nicht mehr als das, was gewachsen ist, sondern als das, was aus biochemischer Sicht optimal zusammengesetzt wurde.
Die Identitätsfrage wird unübersehbar: Ernährung wird nicht nur zu einer politischen Entscheidung zwischen Nachhaltigkeit und Tradition, sondern auch zu einem kulturellen Konflikt zwischen High-Tech-Nahrung und kulinarischem Erbe. Damit stellt sich die Frage, ob es eine Grenze gibt, bis zu der wir Nahrung synthetisieren dürfen. Können wir ein Ernährungssystem schaffen, das sowohl optimiert als auch sinnlich erfahrbar bleibt?

3. Erkenntnistheoretische Spannung: Wer definiert, was Nahrung ist?
Die anstehende Veränderung ist gleichzeitig eine erkenntnistheoretische Disruption. Nahrung war lange Zeit ein Erfahrungsraum, ein Wissen, das sich über Generationen verdichtete. Sie wurde angebaut, geerntet, verarbeitet – in einem physischen, spürbaren Kreislauf, der von einem Jahres- und Vegetationszyklus abhängig ist.
Gegenwärtig wird sie zunehmend das Produkt algorithmischer Berechnungen, biotechnologischer Prozesse und synthetischer Optimierung. Die molekulare Botschaft der Nahrung zu entschlüsseln und die Lebensmittelkomposition nicht nur nutritiv, sondern ebenfalls sensorisch individuell zu gestalten sind Teil der modernen Lebensmittelprozess- und Produktentwicklung. Die Kollision dieser beiden Wissenssysteme wirft grundlegende Fragen auf. Ist Zellkulturfleisch „natürlich“ oder stellt es einen Bruch mit allem dar, was wir über Nahrung wissen? Bedeutet das Verschwinden landwirtschaftlicher Flächen und der Tierproduktion zugunsten von Präzisionsfermentation den Verlust eines kulturellen Gedächtnisses? Werden zukünftige Generationen Ernährung nicht mehr als gelebte Praxis, sondern als mathematisch optimierte Versorgung verstehen?
Dieser Wandel ist nicht nur eine technologische Entwicklung, sondern eine Transformation der Art und Weise, wie wir einen Teil unserer Realität konstruieren. Lebensmittel nehmen wir in unseren Körper auf und verstoffwechseln sie. Der Genuss spielt dabei eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Nahrung ist nicht mehr nur eine Substanz, sondern ein Konzept. Die Frage nach Natürlichkeit ist nicht mehr stofflich zu beantworten, sondern wird zur sozialen Konstruktion. Ernährung wird autopoietisch, erzeugt eigene Gegenerzählungen: Während Biohacker sich der totalen Optimierung verschreiben, formiert sich eine Gegenbewegung, die auf Wildtierjagd, Permakultur und die Renaissance des Handwerks setzt. In dieser Spannung stellt sich die Frage, wer die Zukunft der Nahrung gestaltet – Algorithmen, Konzerne, ProduzentInnen, KonsumentInnen oder alle zusammen?
4. Die dritte Welle: Architektur des Lebens in der neuen Gegenwart
Wie aber bauen wir eine Zukunft, die nicht nur nachhaltig, sondern gleichzeitig erlebbar ist? Verschiedene Ansätze treten in Konkurrenz. Vertical Farming, Aquaponik und geschlossene Kreisläufe bieten eine technologische Antwort auf die Ernährungsfrage, indem sie unabhängig von Klima und Boden Nahrungsmittel in hochkontrollierten Umgebungen produzieren.
Gleichzeitig erlebt die regenerative Landwirtschaft eine Renaissance. Böden werden wieder fruchtbar gemacht, Anbaumethoden auf natürliche Kreisläufe abgestimmt. Dazwischen existiert eine dritte Option: die Welt der synthetischen Biologie. Nahrung wächst nicht mehr auf Feldern oder in Gärten, sondern wird in Bioreaktoren erzeugt. Präzisionsfermentation ermöglicht es, Proteine einschliesslich Enzymen – die ihrerseits einen gezielten Stoffumsatz ermöglichen – Fette und andere Nährstoffe direkt zu synthetisieren. Diese drei Systeme existieren parallel, überlappen sich und widersprechen sich zugleich. Manche schwören auf die technologische Zukunft, andere auf das biologische Erbe. Doch wenn wir nicht in einem endlosen Kampf um «richtig» oder «falsch» verharren wollen, muss eine Metasynthese entstehen – eine Verschmelzung der scheinbaren Gegensätze.
Ein Ernährungssystem, in dem alle Ströme in den Mainstream einfliessen und Abfall oder Seitenströme nicht mehr entstehen, in dem biologische Traditionen und biotechnologische Innovationen nicht als Widerspruch, sondern als symbiotische Kräfte betrachtet werden.
5. Fazit: Die Revolution der Ernährung, die nicht endet Die Zukunft der Ernährung wird nicht durch eine einzelne Technologie oder ein einzelnes Unternehmen bestimmt. Sie wird aus einem dynamischen Wechselspiel entstehen – aus Innovation, Tradition, Widerstand und Akzeptanz. Doch die eigentliche Frage ist nicht nur, welche Produkte wir in Zukunft essen werden, sondern welche epistemische Realität hinter unserer Ernährung steht.
Die Transformation der Lebensmittelindustrie findet auf drei Ebenen statt. Auf der Ebene der ersten Ordnung verändert sich die materielle Struktur der Produktion: Neue Technologien verschieben Märkte, Wertschöpfungsketten und Konsumgewohnheiten. Auf der zweiten Ordnung entsteht eine Reflexion über diesen Wandel: Akzeptanz und Widerstand, Kollision zwischen Tradition und Technologie, zwischen sinnlicher Erfahrung und algorithmischer Präzision. Doch auf der dritten Ordnung werden nicht mehr nur Produkte oder Methoden diskutiert, sondern die Bedingungen, unter denen wir Nahrung überhaupt denken können. Die grösste Entscheidung wird nicht sein, was wir essen – sondern wie wir über Essen denken und welche Wahrnehmungen und Gefühle wir dabei zulassen.
Doch diese Zukunft wird nicht allein von Konzernen oder Algorithmen bestimmt. Sie wird auf den Feldern, in den Bioreaktoren, auf den Märkten, in den Küchen, an den Tischen und unterwegs geformt – von den Menschen, die essen und dabei wahrnehmen, denken und sich mitteilen. Die neue Gegenwart der Nahrung wird nicht nur erfunden. Sie wird erinnert.

Zu den Schreibenden
Das Unerwartete denken und schreiben ist das Motto von Gisela und Tilo Hühn. Gemeinsam verantwortungsvoll handeln, reflektieren und etwas bewirken sind die Eckpfeiler ihres Lebenskonzepts. Die beiden arbeiten als Forschende und Dozierende an der ZHAW: Gisela Hühn in der Forschungsgruppe für Lebensmittel-Prozessentwicklung, Tilo Hühn als Leiter des Zentrums für Lebensmittelkomposition und -Prozessdesign. Ob an der Hochschule oder am Küchentisch: Beide diskutieren und arbeiten gerne – zu zweit oder mit anderen – zu zukünftigen Ernährungssystemen sowie zu der Frage, wie man bei der Verarbeitung mehr vom Guten aus Agrarprodukten erhält.
-
P
Der Inhalt des Textes erschliesst sich mir nicht - zu viele Fremdwörter, zu viel Fachvokabular. Im Hinterkopf habe ich Soylent Green 🤷♂️
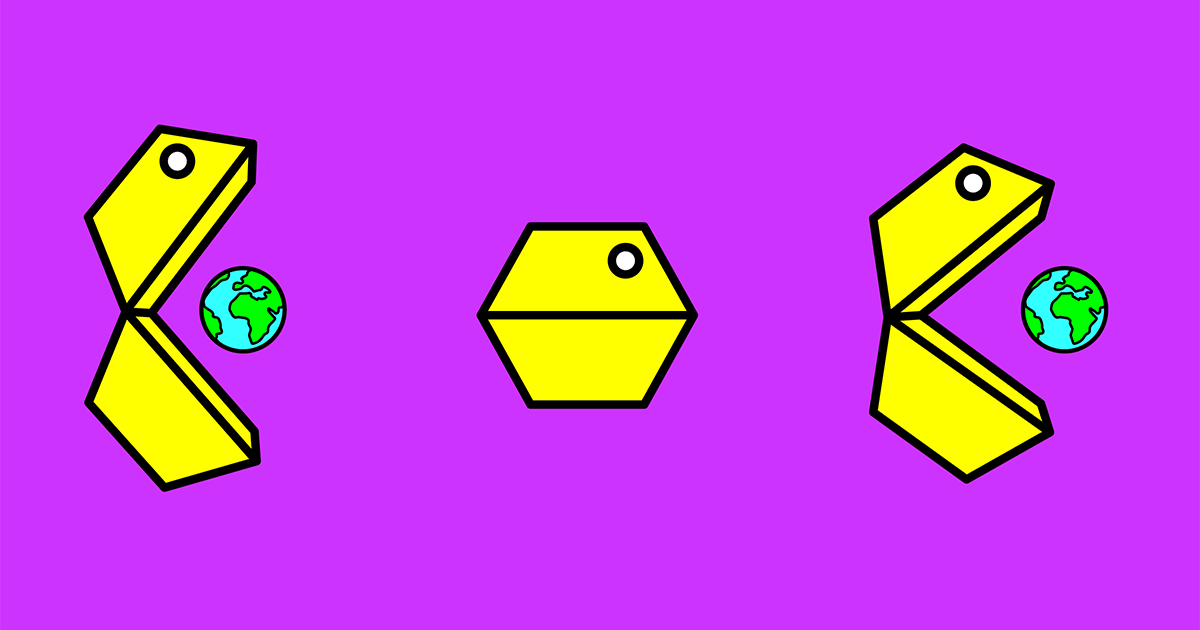
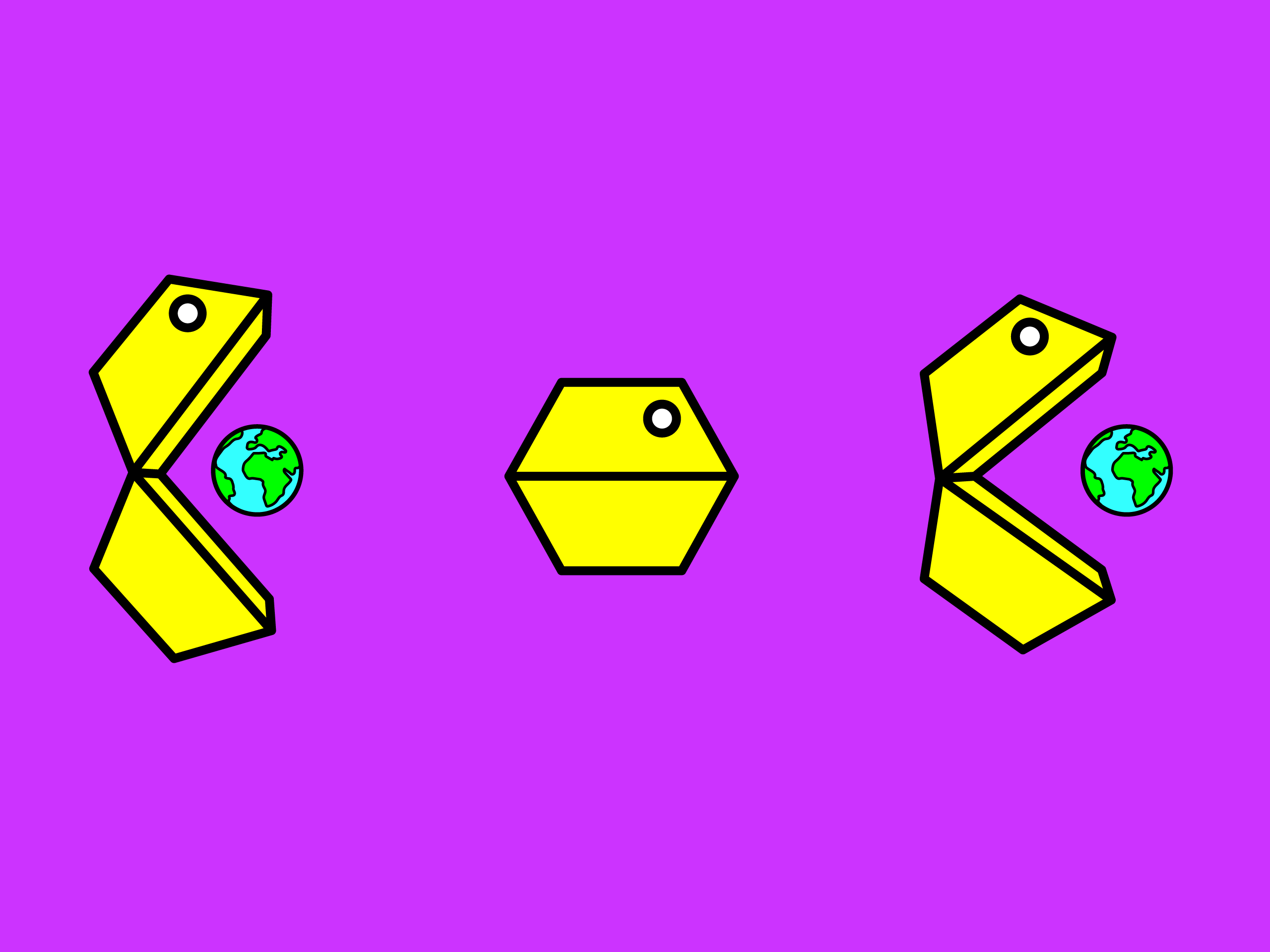
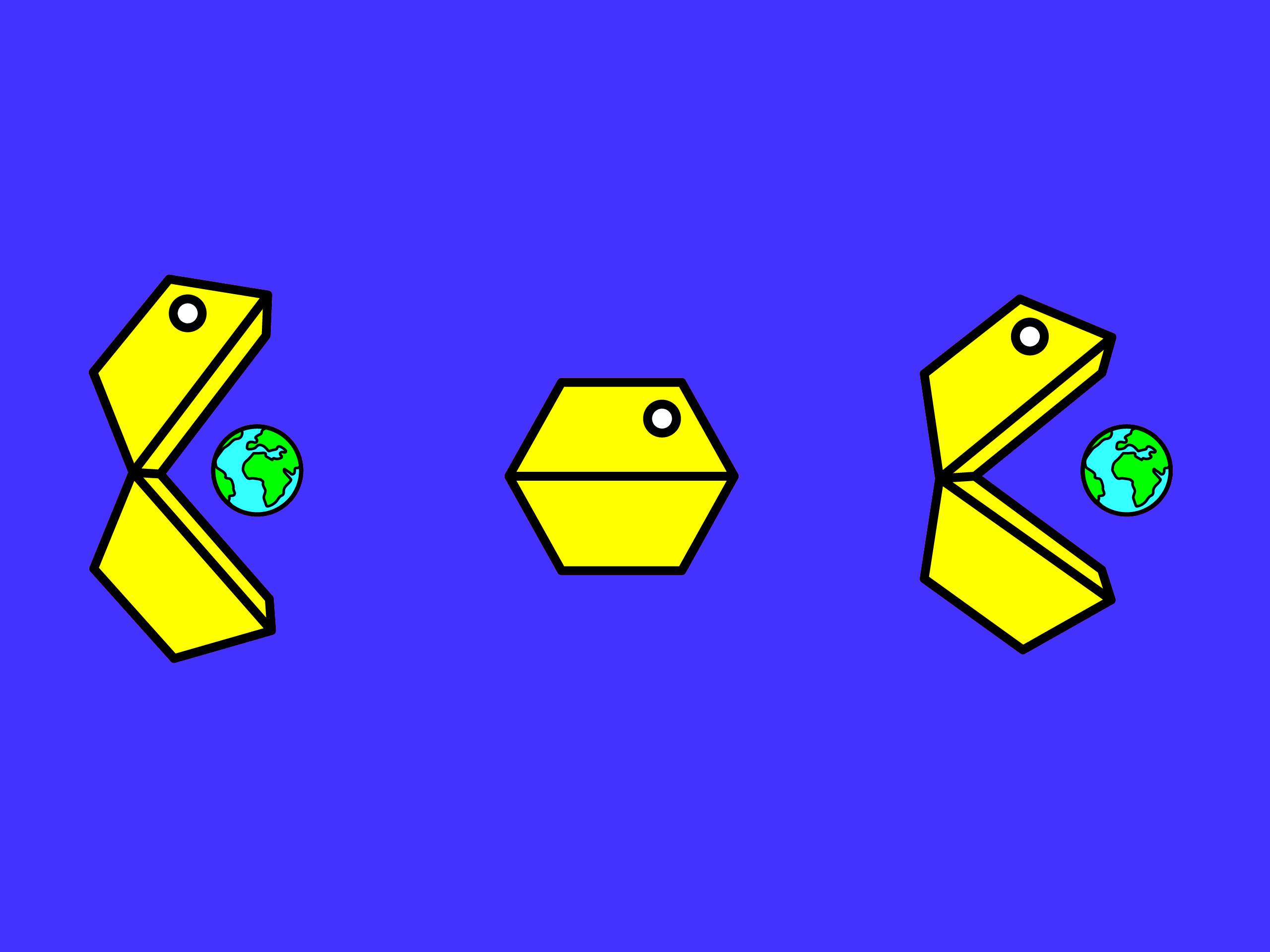
1 Kommentar