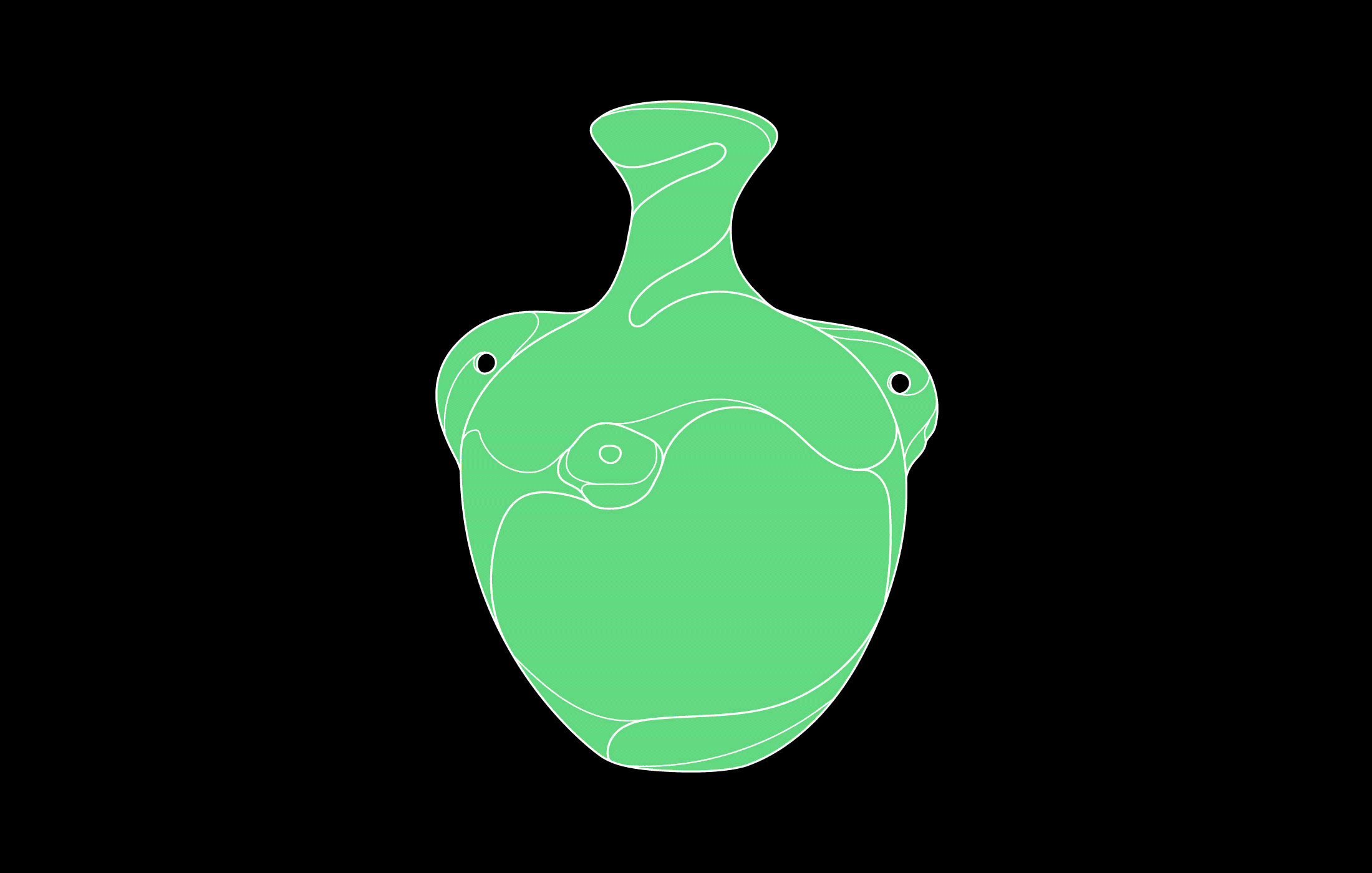
Grosse Ideen von der Wiege bis zur Gegenwart
Schon früh begann die Menschheit, ihr Umfeld anzupassen und mit künstlichen Hilfsmitteln zu optimieren. Dieser Beitrag zeigt die Anfänge von neun Themenbereichen. Wie weit sich diese bis heute entwickelt haben, welche Lösungen möglich sind und an welchen Fragen getüftelt wird, darüber berichten die Artikel im Dossier «Natürlich und künstlich».
Ca. 9000 vor unserer Zeitrechnung: Fermentation
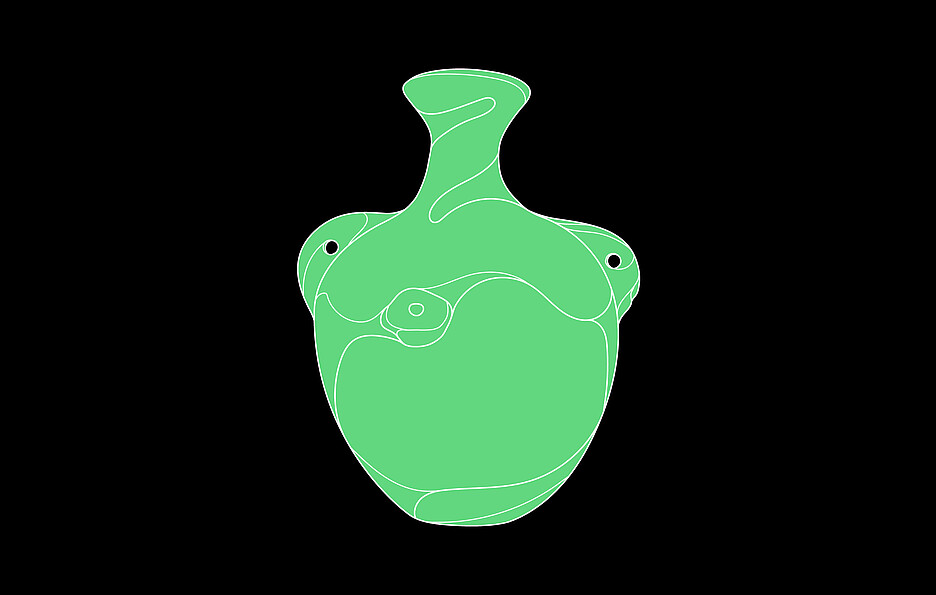
Man geht davon aus, dass Fermentation seit Jahrtausenden angewandt wird, um Lebensmittel haltbar zu machen und geschmacklich zu verbessern. Erste nachweisbare Belege für fermentierte alkoholische Getränke finden sich im chinesischen Dorf Jiahu. In Keramikgefässen wurden Reis, Honig, Trauben und Weissdorn gemeinsam vergoren.
Ca. 7500 v. u. Z.: Künstliche Baustoffe

Bereits in den frühen Hochkulturen werden Lehmziegel erstellt und mit Mörtel vermauert. Die Römer mischen dieser Masse zusätzlich Vulkanasche bei. Dadurch wird sie wasserunlöslich und enorm fest, was Bauwerke wie das Pantheon bis zum heutigen Tag beweisen. Mit der Erfindung des Zements als Bindemittel legen drei britische Ingenieure zwischen 1750 und 1850 den Grundstein dafür, dass Beton zum weltweit dominierenden Baustoff wird.
Ca. 1000 v. u. Z.: Künstliche Pflanzen

Künstliche Blumen werden bereits im Alten Testament erwähnt. Die Königin von Saba soll damit geprüft haben, ob König Salomon diese als solche erkannte, und somit, ob er ihrer würdig war. Im antiken Griechenland und im römischen Reich werden künstliche Blumen aus Wachs, Seide oder Papyrusrinde hergestellt. Als Alternative zu schnell welkenden echten Blumen sind sie in wohlhabenden Kreisen verbreitet.
1844: Kunststoffe

Durch die Zugabe von Schwefel zu Kautschuk entsteht ein elastischer und stabiler Werkstoff: Charles Goodyear hat mit Gummi den ersten biobasierten Kunststoff entwickelt und lässt seine Erfindung patentieren. Er tüftelt an verschiedenen Produkten, von Gummistiefel über Ballons bis zu Kondomen. Der grosse Durchbruch gelingt ihm aber nicht. 1907 erfindet der belgisch-amerikanischen Chemiker Leo Baekeland «Bakelit», den ersten vollsynthetischen Kunststoff. Er ist hitzebeständig, langlebig und isoliert gut.
1915: Künstliche Krebszellen

Zwei japanische Forscher führen eine Hautkrebserkrankung künstlich herbei, indem sie die Ohren von Hasen immer wieder mit Teer bestreichen. 1951 wird aus einer Gewebeprobe einer Krebspatientin die erste unsterbliche Zelllinie etabliert – ein Meilenstein für die Krebsforschung. Seit den 2010er-Jahren lassen sich aus Stammzellen von Krebskranken künstliche Tumore für Medikamententests züchten.
1956: Künstliche Intelligenz

Der Begriff «künstliche Intelligenz» wird erstmals im Rahmen des Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, eines sechswöchigen Workshops am Dartmouth College in New Hampshire, verwendet. Zehn Wissenschaftler nehmen an dieser Veranstaltung teil, die sich um die Frage dreht, ob Maschinen einst dazu fähig sein können, Probleme zu lösen, die bisher dem menschlichen Denken vorbehalten waren.
1958: Automatisiertes Autofahren

Chrysler bringt die ersten Serienfahrzeuge mit Tempomat auf den Markt und macht damit den ersten Schritt in Richtung autonomer Mobilität. Ein vollständig automatisiert fahrendes Fahrzeug fährt erstmals 1986 an der Universität der Bundeswehr München über einen Testkurs: das Versuchsfahrzeug VaMoRs. Lenkung, Gas und Bremsen sind computergesteuert – zwei Schränke voll mit Rechnern sind dazu nötig.
1968: Virtual Reality

Erste Unterhaltungsgeräte, die beim Durchschauen Dreidimensionalität vortäuschen, sind seit den 1930er-Jahren bekannt. Ivan Sutherland von der Universität Utah präsentiert 1968 mit einer tragbaren Datenbrille das erste Gerät, das am Kopf befestigt wird. Virtuelle Welten kommen in den 80er-Jahren auf: Das Spiel «Habitat» gilt als erstes Game, das Spielende in Echtzeit in einem virtuellen Raum miteinander interagieren und kommunizieren lässt.
2002: Digitale Zwillinge

Michael Grieves präsentiert an der Universität Michigan das Konzept des digitalen Zwillings: Ein virtuelles Spiegelbild eines Produkts soll dieses in jeder Lebensphase begleiten. Insbesondere durch das Internet der Dinge und die grosse Verfügbarkeit an Daten wird das Konzept in den 2010er-Jahren weiterentwickelt und auf immer neue Branchen übertragen. Mit digitalen Zwillingen lassen sich Funktionen von Produkten überwachen, besser verstehen und optimieren.
Quellen: Penn Museum; Ernährungsumschau; Baustoffwissen; welt.de; The American Museum of Natural History; Boell.de (Plastikatlas 2019); acs.org; Sekiya, Takao (2024), The first artificial cancer in the internal organs of experimental animals. 10.2183/PJAB.100.038; Hopkins; ORF; Darthmouth College; Süddeutsche Zeitung; Ambrosio, A. P., & Fidalgo, M. a I. R. (2020). Past, present and future of Virtual Reality: Analysis of its technological variables and definitions. ; Singh, M.; Fuenmayor, E.; Hinchy, E.P.; Qiao, Y.; Murray, N.; Devine, D. Digital Twin: Origin to Future. Appl. Syst. Innov. 2021, 4, 36.
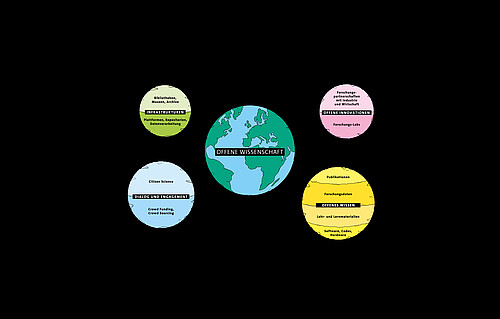
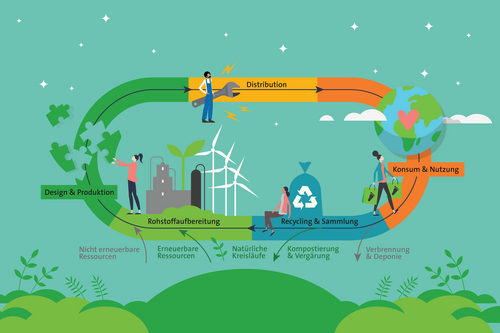

0 Kommentare
Sei der Erste der kommentiert!