
Vom Wunsch, kinderlos zu bleiben, von einer SAC-Hütte und Zwangsarbeit
Was erleben junge Menschen, wenn sie sich sterilisieren lassen wollen? Wie lässt sich die Konkordiahütte nachhaltiger betreiben? Und: Woran können Hebammen Menschenhandel erkennen?
Woran Hebammen Ausbeutung erkennen
Jemand kann seine Adresse nicht angeben, ist nicht krankenversichert und wird stets begleitet: Dies können Hinweise auf Menschenhandel und Zwangsarbeit sein. Betroffene sind oft extremen Formen von körperlicher, sexueller sowie physischer Ausbeutung ausgesetzt und werden von der Aussenwelt abgeschottet. Sich zu wehren oder Hilfe zu holen, fällt ihnen schwer. Entscheidend seien Drittpersonen, die ihre Situation erkennen, stellen Angèle Lavignac und Sahar Ana Richter fest. «Gesundheitsfachpersonen könnten eine grössere Rolle beim Erkennen von Menschenhandel spielen», sagen sie. Ärztinnen, Ärzte, Pflegende und Hebammen zählten zu den wenigen Berufsgruppen, die mit Betroffenen direkt in Kontakt kommen. «Damit sie adäquat reagieren können, müssen sie sensibilisiert und geschult werden.» Die Autorinnen listen Merkmale für eine mögliche Ausbeutung auf. Dazu zählen Sprachbarrieren, fehlende Ausweisdokumente, Drogenkonsum und auffällige Begleitpersonen. Betroffene nehmen eher spät medizinische Hilfe in Anspruch. Sie leiden häufig unter nicht unfallbedingten Verletzungen und gynäkologischen Beschwerden. «Es braucht ein geschultes Auge, um Menschenrechtsverletzungen zu erkennen», sagt Angèle Lavignac. Betroffene seien im Sexhandel, aber ebenso auf Baustellen oder in Haushalten zu finden. Bei einem Verdacht sollten Hebammen sensibel nachfragen und über Unterstützungsangebote informieren, sagt Sahar Ana Richter. «Dafür sollten sie mit der Person allein sein.»
Angèle Lavignac (26) und Sahar Ana Richter (25) sind der Frage nachgegangen, wie Hebammen Menschenhandel erkennen können. Sie geben Empfehlungen, wie Betroffene im Rahmen der Geburtshilfe unterstützt werden können. Ihre Bachelorarbeit ist mit der Höchstnote bewertet und als beste des Jahrgangs ausgezeichnet worden. Die ZHAW-Absolventinnen haben zudem den zweiten Platz des Sustainable Development Goal Award erreicht. Sie absolvieren zurzeit ein Praktikum im Triemli-Spital.

Wie eine SAC-Hütte nachhaltiger wird
Die Konkordiahütte liegt auf einem Felsen hoch über dem Aletschgletscher. Zu erreichen ist sie über das Eis und steile Metalltreppen. SAC-Hütten seien zugleich «Betroffene» wie auch «Mitverantwortliche» der Umweltproblematik, stellt Lara Bieler fest, die am Departement für Life Sciences und Facility Management studiert hat. «Einerseits sind sie stark von den klimatischen Veränderungen betroffen, da Gletscherschmelze und sinkende Wasserreserven ihre Versorgungssicherheit und Infrastruktur erheblich belasten. Andererseits tragen sie durch ihren Betrieb auch selbst zur Umweltbelastung bei.» Ein grosser Teil der CO₂-Emissionen ist auf Transporte per Helikopter zurückzuführen. Bieler zeigt auf, dass sich diese durch eine optimierte Logistik deutlich senken lassen. Schmelzwasser könnte nicht nur für Heissgetränke, sondern auch als Trinkwasserquelle genutzt werden, damit weniger PET-Flaschen angeliefert werden müssen. Die Toilettenabfälle liessen sich durch eine Wurmkompostierung verringern. Handlungsbedarf sieht die Autorin zudem bei den Abwasserströmen. Sie schlägt eine stromlose Klein-Kläranlage vor, um stark verschmutztes Wasser aus der Küche aufzubereiten, bevor es in die Umwelt gelangt. Mit einer Recycling-Station könnte leicht verschmutztes Wasser aus Duschen und Lavabos für die Textilwaschmaschine wiederverwendet werden. Das Energiesystem liesse sich mit einer Wärmepumpe und einer erweiterten Photovoltaikanlage optimieren. «Schon einfache Massnahmen, die ressourcenarm umzusetzen sind, würden viel bewirken.»
Lara Bieler (26) hat untersucht, wie die Stoff- und Energieflüsse der Konkordiahütte verbessert werden könnten. Die Umweltingenieurin kennt das grösste Gasthaus des Schweizer Alpen Clubs (SAC) gut. Sie hat mehrere Sommersaisons im Betrieb auf dem Alteschgletscher gearbeitet. «Dabei ist mir einiges aufgefallen, was man nachhaltiger organisieren könnte», sagt sie. Aktuell erfülle die Hütte die Klimaziele des SAC nicht. Die Bachelorabsolventin ist beim Planungsbüro sundesign photovoltaic engineering in Stallikon tätig.

Sterilisation in jungen Jahren
Zwischen Selbstbestimmung und Vorurteilen: So umschreibt Jacqueline Wechsler, was junge Menschen erleben, die keine Kinder bekommen und sich sterilisieren lassen möchten. In ihrem Podcast zeigt sie anhand von vier Personen auf, wie unterschiedlich der Weg zum operativen Eingriff sein kann. «Er ist in manchen Fällen schwierig, aber durchaus möglich», sagt sie. Kaum negative Erfahrungen machte eine heute 57-jährige Frau, die sich 1996 ihre Eileiter veröden liess. Gesetzliche Bestimmungen spezifisch zur Sterilisation gab es damals noch nicht. Erst 2005 wurde etwa festgelegt, dass Patientinnen oder Patienten volljährig und urteilsfähig sein müssen. «Es hat mich überrascht, wie reibungslos sich diese Gesprächspartnerin sterilisieren lassen konnte», sagt Wechsler, die am Departement Angewandte Linguistik studiert hat. Deren Gynäkologin habe die Operation bereits nach einem Gespräch aufgegleist. «Das ist auch heute noch nicht selbstverständlich.»
Eine andere Frau berichtet, dass sie sich von Ärztinnen und Ärzten zu wenig ernst genommen fühlte. Als sie sich mit 21 Jahren für den Eingriff anmelden wollte, hiess es, sie sei viel zu jung dafür. Sie wurde immer wieder zu Besprechungen aufgeboten und unter anderem gefragt, was ihr Partner von ihren Plänen halte. «Sie wollten mich einfach nicht verstehen», kritisiert die Frau. «Das war frustrierend.» Erst nach einem psychologischen Gutachten wurde sie schliesslich operiert. Mit deutlich weniger Aufwand gelangte der einzige männliche Protagonist des Audiostücks ans Ziel. Er wurde mit 24 Jahren unmittelbar nach dem Vorgespräch unterbunden. Er vergleicht seine Vasektomie mit einem «aufgeschobenen Zahnarztbesuch, den man endlich gemacht hat.»
Jacqueline Wechsler (26) hat einen Podcast mit dem Titel «Kinderlos und sterilisiert: Zwischen Selbstbestimmung und Vorurteilen» produziert. Sie hat sich dabei an der SRF-Sendung «Input» orientiert und vier persönliche Geschichten mit der Einordnung einer Psychologin kombiniert. «Auditive Formate eignen sich gerade für gesellschaftlich relevante und emotionale Themen gut», sagt die ZHAW-Absolventin. Sie hat die Note 6 erhalten und ist vom «Landboten» für die beste Bachelorarbeit im Bereich Journalismus ausgezeichnet worden. Sie arbeitet als Kommunikationsspezialistin bei Fruitjuicer in Weinfelden.
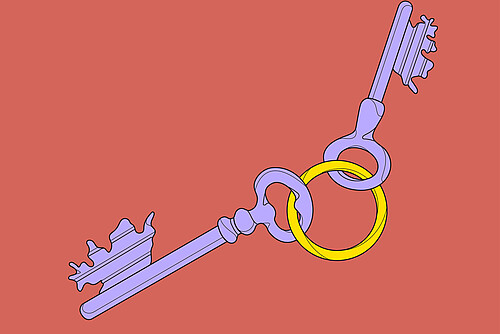
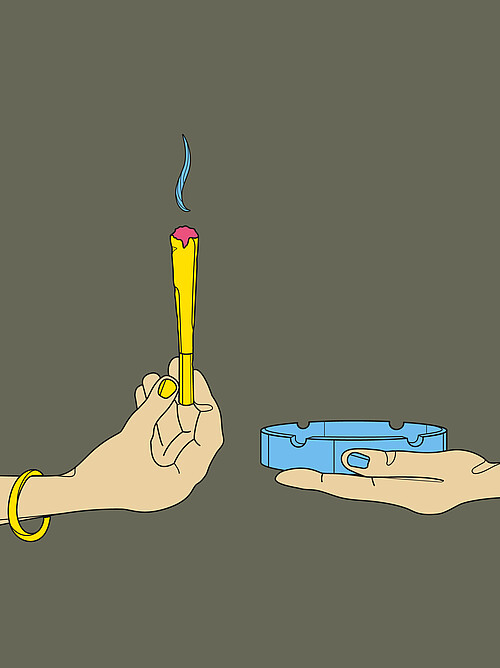
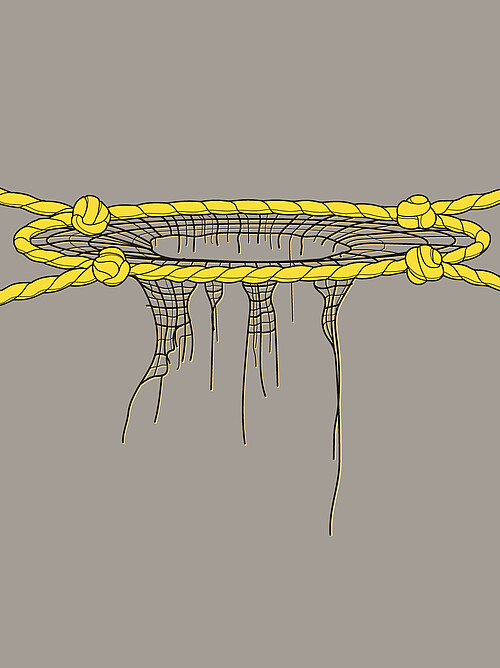
0 Kommentare
Sei der Erste der kommentiert!